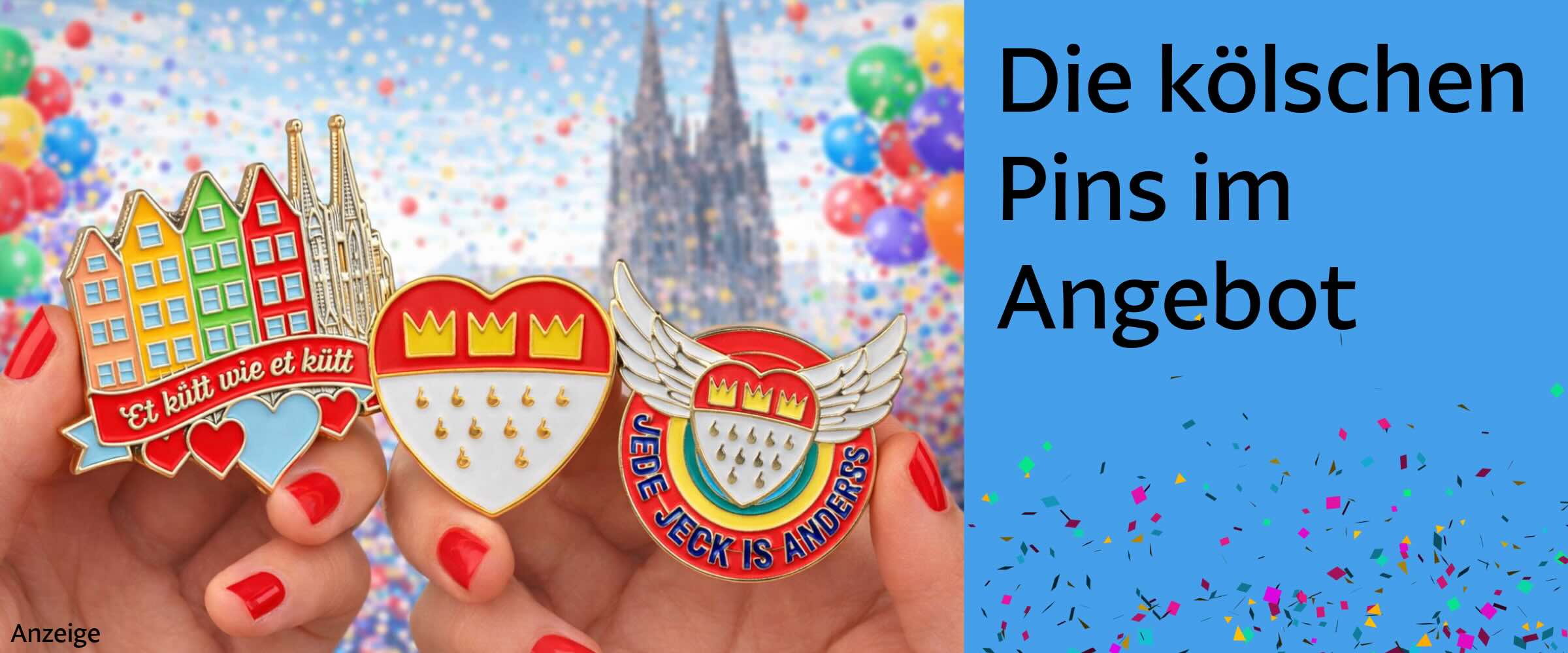Wer im Kölner Brauhaus Platz nimmt, begegnet ihm früher oder später: dem Kölsch-Kranz. Mit einem Griff in der Mitte, gefüllt mit bis zu zwanzig Kölsch-Stangen, gehört er fest zum Bild der Brauerei-Kultur in Köln. Doch woher kommt dieser Ring voller Gläser, der so selbstverständlich durch die Brauhäuser getragen wird?
Warum ein Kranz Kölsch?
Der Ursprung des Kranzes liegt weniger in einer spektakulären Erfindungsgeschichte als vielmehr im Alltag der Kölner Brauhäuser. Schon im 19. Jahrhundert wurde Kölsch – wie alle obergärigen Biere der Region – traditionell in kleinen Gläsern ausgeschenkt. (Foto: IMAGO / Winfried Rothermel)

Die „Stange“ mit 0,2 Litern soll sicherstellen, dass das Bier immer frisch und kühl getrunken wird. Für die Köbesse, die Servierer in den Brauhäusern, ergab sich daraus ein Problem: Mit einzelnen Gläsern ständig zwischen Zapfhahn und Tisch zu laufen, wäre kaum zu bewältigen gewesen.
Das ist übrigens heute der Grund, warum in der Außengastronomie das Kölsch häufig in 0,3l Stangen ausgeschenkt wird: Der Köbes muss dann nicht ständig hin und herlaufen. Beim Zapfen ist der Kranz ebenfalls praktisch, denn wenn es mal richtig schnell gehen muss, kann man die Gläser unterm Zapfhahn direkt im Kranz befüllen.
Kölsch-Kranz sichert den Nachschub im Brauhaus
Die Lösung damals war ein rundes Tragegestell mit Einlassungen für die schmalen Stangen. In der Mitte ein Griff, außen die Gläser – fertig war der Kranz. Damit konnten die Köbesse auf einen Schlag eine ganze Tischrunde versorgen.
Tabletts, wie sie anderswo üblich waren, eigneten sich wegen der schmalen, hohen Gläser kaum. Der Ring bot Stabilität, Geschwindigkeit und machte die Arbeit im hektischen Brauhausbetrieb überhaupt erst praktikabel – bis heute.
Woher der Name Kranz kommt
Dass der Begriff „Kranz“ gewählt wurde, liegt nahe: Die ringförmige Anordnung der Gläser erinnerte an einen Blumen- oder Adventskranz. Der Begriff setzte sich schnell durch und wurde Teil des kölschen Sprachgebrauchs – eine gesondere Ursprungserzählung gibt es nicht.
Aus dem Verliebt in Köln-Shop:Wie viele Gläser passen hinein?
Klassisch fassen Kränze zwischen 11 und 20 Stangen, meist also rund dreieinhalb Liter Kölsch. Eine einheitliche Norm gibt es nicht – wichtig ist allein, dass der Köbes viele Gäste auf einmal bedienen kann.
Teil des kölschen Systems
Der Kranz symbolisiert ein ganzes Servierprinzip. Der Köbes geht nicht auf Bestellung zum Tisch, sondern kontrolliert laufend die Gläser der Gäste. Wer sein Kölsch geleert hat, bekommt automatisch ein neues aus dem Kranz – es sei denn, er legt den Bierdeckel auf das Glas.
So wird die Tradition des „immer frisch gezapften Kölsch“ aufrechterhalten, und der Abend im Brauhaus erhält seinen besonderen Rhythmus. Jeder kennt und liebt es: Im Brauhaus wartet man nie auf ein Getränk, der Nachschub ist ständig garantiert, was in einigen Fällen zu heiteren Stunden führt.
Heute ist der Kranz längst ein Kultsymbol. Touristen fotografieren ihn, bevor sie ihr Kölsch trinken, und in Souvenirshops gibt es Miniatur-Kränze als Schlüsselanhänger. In Brauhäusern gehört er ganz selbstverständlich zum Alltag.
- Zum Thema: Welcher Köbes-Typ wärst du? Mach den Test