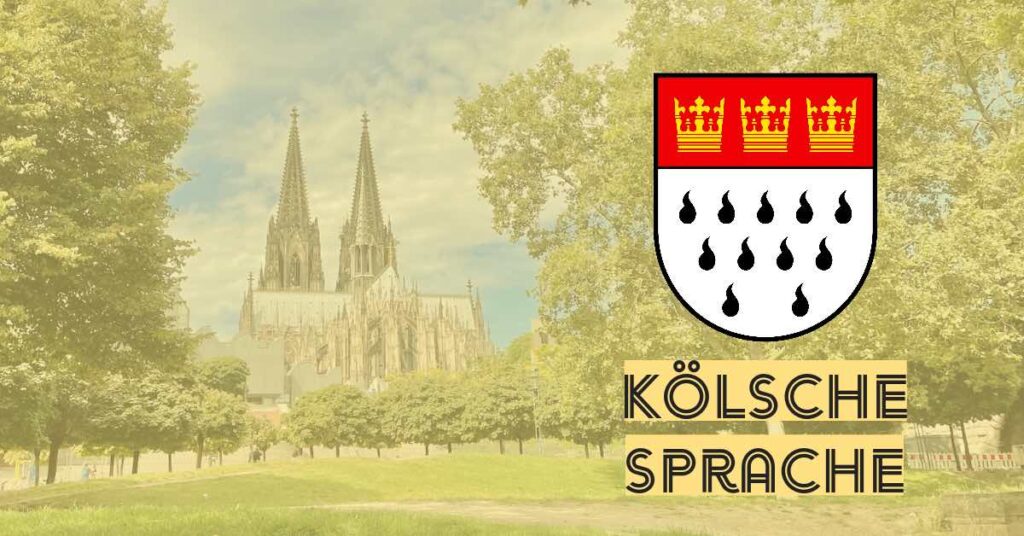Wer in Köln unterwegs ist, hört es ständig: Aus Marie wird Marieche, aus Hans das Hännesche. Auf Hochdeutsch klingt das schnell verniedlichend oder gar respektlos – im Kölschen ist es das genaue Gegenteil. Das kleine „-che“ ist eine typisch kölsche Besonderheit, die Nähe und Zuneigung ausdrückt.
Die Sprachwissenschaft spricht dabei von so genannten Diminutiven, also Verkleinerungsformen. Im Hochdeutschen kennen wir vor allem „-chen“ oder „-lein“ – aus dem Haus wird ein Häuschen, aus dem Kind ein Kindlein.
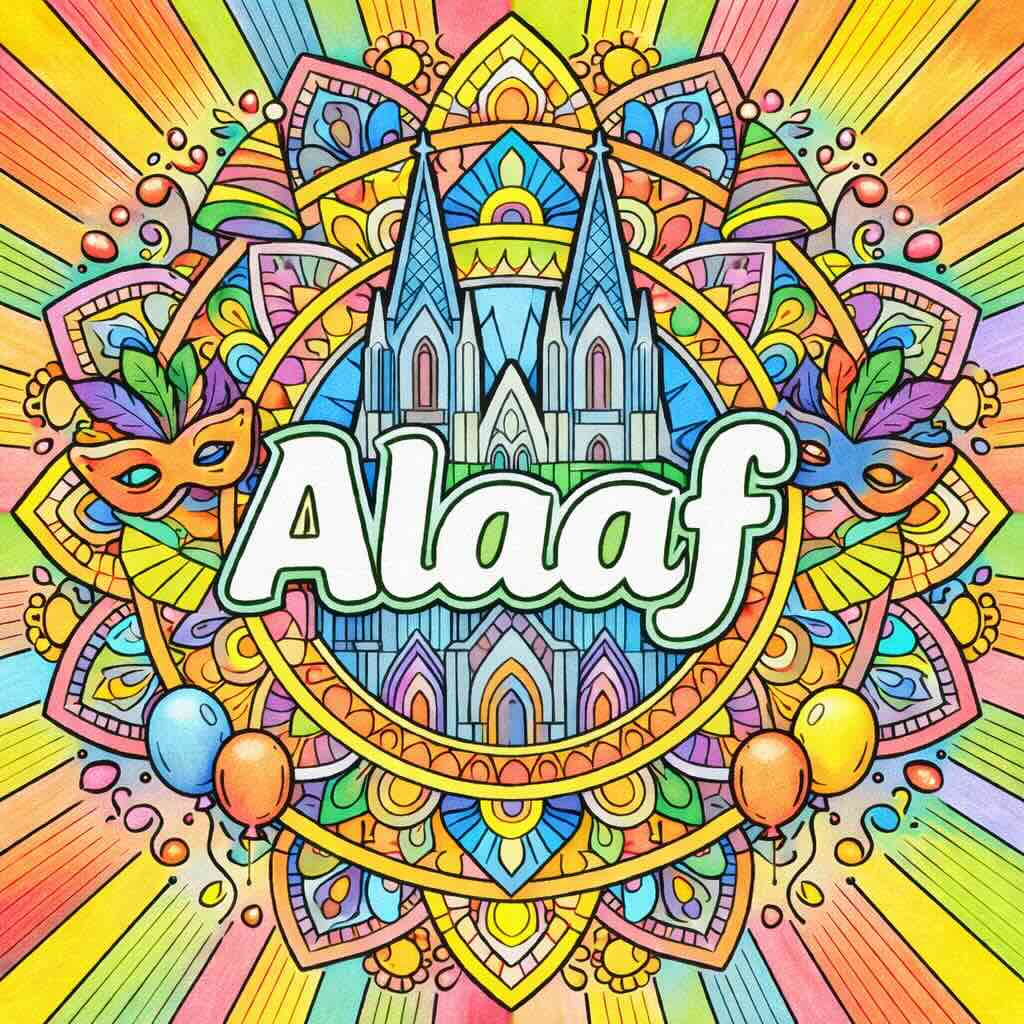
In der kölschen Sprache hat sich dafür die Endung „-che“ durchgesetzt. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) beschreibt, dass dieses „-che“ viel häufiger genutzt wird als im Hochdeutschen. Es taucht nicht nur bei Dingen, sondern auch bei Menschen und sogar bei Orts- oder Familiennamen auf.
Marieche und Hännesche
Gerade bei Vornamen ist die kölsche Verniedlichung fest verankert. „Et Marieche“ steht dabei nicht für eine kleine oder schwache Marie, sondern für eine vertraute, liebevolle Anrede. Ähnlich verhält es sich mit anderen Namen.
Besonders bekannt ist die kölsche Puppenspielfigur „Hänneschen“, die seit über 200 Jahren auf der Bühne des Hänneschen-Theaters steht. Ohne das „-che“ wäre der Name kaum vorstellbar.
Nähe statt Respektlosigkeit
Wichtig ist: Im Kölschen wird niemand durch die Verniedlichung abgewertet. Im Gegenteil – das „-che“ signalisiert Vertrautheit, manchmal auch Humor. Wer „Marieche“ sagt, stellt damit eine Nähe her, die im distanzierteren Hochdeutschen oft fehlt.
Es passt zum kölschen Lebensgefühl: ein bisschen lockerer, herzlicher, weniger förmlich.
Aus dem Verliebt in Köln-Shop:Kölsche Tänze und die Verniedlichung
Das Prinzip findet sich auch in Redewendungen und Traditionen wieder. Ein bekanntes Beispiel ist der „Stippeföttche“-Tanz. Das Wort leitet sich von „stippe“ (stoßen) und „Föttche“ (Po, kleines Hinterteil) ab.
Die Verniedlichung steckt hier schon im Wort – sie macht das Tänzchen fröhlich und weniger derb. Und Tanzmarie klingt ja ehrlicherweise auch weniger vertraut als Tanzmariechen.
Ein kleines „-che“ mit großer Wirkung
Die kölsche Sprache lebt von solchen Nuancen. Wer einmal darauf achtet, entdeckt sie überall: im Büdchen, auf der Straße, in Karnevalsliedern. Das „-che“ ist dabei weit mehr als ein Anhängsel. Es ist ein sprachlicher Ausdruck für Zuneigung, Nähe und kölsche Herzlichkeit. Und es zeigt, dass man in Köln manchmal nur ein kleines Wort braucht, um eine ganze Haltung zu transportieren.
Zum Thema: Warum man auf Kölsch nicht einfach „Ich esse“ sagt