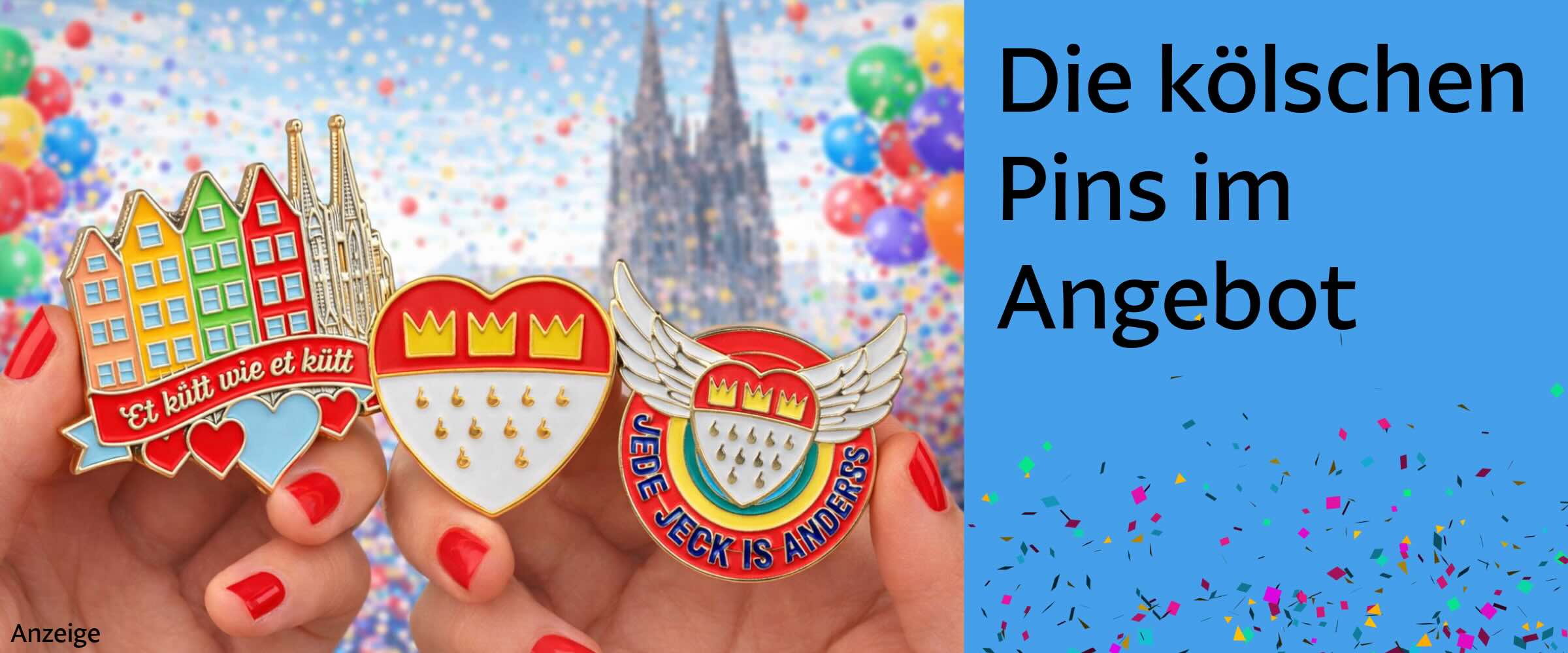Zwischen Frankfurter Straße und Bahntrasse, dort wo Köln-Höhenberg beginnt, liegt ein stilles Denkmal der Stadtentwicklung: die Germaniasiedlung. Was auf den ersten Blick wie ein normales Wohnviertel wirkt, gehört in Wahrheit zu den bedeutendsten Siedlungsanlagen Kölns – und weit darüber hinaus.
Ab 1919 ließ die GAG, die „Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Wohnungsbau“, die Siedlung auf dem Gelände eines ehemaligen Hüttenwerks errichten. Der Stadtteil Kalk war bereits dicht bebaut, also wich man weiter nach Osten aus. Benannt wurde die Siedlung nach der „Germaniahütte“, einem montanindustriellen Vorläuferbetrieb aus dem 19. Jahrhundert.
Die GAG kaufte das Areal mitten im Ersten Weltkrieg – mit dem Ziel, dort erschwingliche Wohnungen für Arbeiter und Angestellte zu schaffen. Hinter dem Projekt standen Persönlichkeiten wie Oberbürgermeister Konrad Adenauer und Unternehmer wie Alfred Neven DuMont.
In zwölf Bauabschnitten entstand zwischen 1919 und 1929 eine Siedlung mit ursprünglich 1.459 Wohnungen und 17 Ladenlokalen. Was die Germaniasiedlung architektonisch besonders macht, ist ihre Vielfalt: Ganze 38 – überwiegend Kölner – Architekten arbeiteten an den einzelnen Häuserzeilen. Dennoch wirkt das Viertel in sich geschlossen.

Der Grund dafür liegt in der städtebaulichen Gesamtplanung, für die GAG-Direktor Fritz-Hans Kreis verantwortlich war. Er versuchte, das Ideal der Gartenstadt mit dem Geschosswohnungsbau zu vereinen – und schuf so eine Reformhaussiedlung neuen Typs.
Ursprünglich war eine reine Einfamilienhaussiedlung vorgesehen. Doch wirtschaftliche Zwänge – unter anderem die Hyperinflation der 1920er Jahre – führten zu einem Umdenken. Ab dem zweiten Bauabschnitt dominierten Mehrfamilienhäuser. Heute prägen Fünf- und Sechsparteienhäuser das Bild der Siedlung, wie der LVR auf seiner Webseite zur Siedlung berichtet.
Gestalterisch orientierte man sich am sogenannten Heimatstil städtischer Prägung. Die Architektur variiert: Torbögen, Erker, Zinnen, Putzflächen im Wechsel mit Backsteinornamentik. Auch der Grundriss der Siedlung ist besonders: ein asymmetrisches Fünfeck mit unterschiedlich breiten Straßen, das an das mittelalterliche Köln erinnern soll. Die Mischung aus Blockrand- und Zeilenbebauung schafft trotz Dichte immer wieder grüne Innenhöfe und Gemeinschaftsflächen.

Der soziale Gedanke war integraler Bestandteil: Eine Schule, Konsumanstalt und der zentrale Weimarer Platz als Begegnungsort gehörten von Anfang an dazu. Die Bewohner kamen aus unterschiedlichen Schichten – Industriearbeiter, Reichsbahnbeamte, Postangestellte. Verwaltet wurde die Siedlung genossenschaftlich – durch die „Bewohnergenossenschaft Eigenheim Mülheim“.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Siedlung teilweise zerstört. Die 1950er-Jahre-Rekonstruktionen verzichteten aus Kostengründen auf viele historische Details. Das änderte sich erst 2005: Die GAG begann eine umfassende Sanierung, die mit dem Deutschen Bauherrenpreis für Modernisierung ausgezeichnet wurde. In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurden 113 Häuser instandgesetzt, energetisch ertüchtigt und dabei äußerlich in den Zustand der 1920er Jahre zurückgeführt – inklusive originaler Dachgauben und Farbgebung.

Ein besonderes Highlight: die Museumswohnung im Paul-Schwellenbach-Haus. Sie wurde gemeinsam mit dem Kölnischen Stadtmuseum eingerichtet und zeigt, wie man hier vor 100 Jahren gelebt hat – mit Originalmöbeln, alten Fotos und viel Liebe zum Detail.
Die Museumswohnung befindet sich an der Weimarer Straße 15, 51103 Köln.
Besichtigungen ohne Führung sind in der Regel
- donnerstags zwischen 11:00 und 13:00 Uhr und
- sonntags auf Anfrage zwischen 14:30 und 16:00 Uhr möglich.
Weitere Infos zur Museumswohnung auf dieser Seite der GAG.
Heute ist die Germaniasiedlung mehr als nur ein Wohnviertel. Sie ist ein stadtbildprägendes Denkmal des sozialen Wohnungsbaus, ein architektonisches Mosaik der Weimarer Republik – und ein Stück Köln, das mit viel Sorgfalt in die Zukunft geführt wurde.
Anfahrt: Mit der Bahn kommt ihr mit der Linie 1 Richtung Bensberg (Haltestelle Fuldaer Str.) zur Siedlung.